Rechtsgrundlagen für Umgang mit Problempflanzen
Die Schweiz geht gegen invasive Neophyten vor. Gesetzliche Grundlagen – insbesondere die Freisetzungsverordnung – legen fest, welche Arten verboten sind und wie mit ihnen umgegangen werden muss. Ziel ist es, Natur, Landwirtschaft und Gesundheit zu schützen und die weitere Ausbreitung problematischer Pflanzen zu verhindern.
Um die Ausbreitung von Invasiven gebietsfremden Pflanzenarten einzudämmen, hat die Schweiz klare gesetzliche Grundlagen geschaffen. Zentral ist dabei die Freisetzungsverordnung (FrSV), die festlegt, welche Pflanzenarten nicht mehr eingeführt, verkauft oder weitergegeben werden dürfen. Seit dem 1. September 2024 sind 53 invasive Pflanzenarten oder -gruppen rechtlich geregelt. Ausserdem sind Pflanzenteile verbotener Arten so zu entsorgen, dass keine Vermehrung stattfinden kann – etwa über offizielle Sammelstellen.
Die Schweiz beherbergt rund 4’000 Wildpflanzenarten. Davon sind etwa 750 Neophyten, also gebietsfremde Arten. 88 gelten als invasiv oder potenziell invasiv, während die übrigen rund 660 ohne bekannte problematische Auswirkungen bleiben. Für die Regulierung der 53 invasiven Pflanzenarten greift die FrSV, die in den Anhängen 2.1 und 2.2 unterschiedliche Verbote festlegt.
Die Freisetzungsverordnung (FrSV) stützt sich auf das Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und regelt den Umgang mit gebietsfremden Arten. Zuständig sind Bund (BAFU: Vorschriften, Artenlisten, Koordination), Kantone (Vollzug, Kontrolle, Bekämpfung) sowie Gemeinden (Information und Vollzugsaufgaben gemäss kantonaler Regelung). Am 1. März 2024 hat das BAFU die revidierte FrSV publiziert; die Änderungen treten am 1. September 2024 in Kraft.
Neu gilt ein umfassendes Abgabeverbot (Inverkehrbringungsverbot) für alle in den Anhängen 2.1 und 2.2 aufgeführten Pflanzenarten. Dieses umfasst insbesondere: Einfuhr, Verkauf, Vermietung, Transport, Lagerung, Tausch, unentgeltliche Abgabe (Verschenkung) sowie Zusendung zur Ansicht. Unter Inverkehrbringen versteht man jede entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe an Dritte. Damit ist jegliche Form der Abgabe – auch ohne kommerziellen Zweck – verboten.
Für 22 invasive Pflanzenarten oder -gruppen gilt ein vollständiges Umgangsverbot. Diese Arten dürfen weder gepflanzt, noch vermehrt, weitergegeben oder transportiert werden. Zulässig ist einzig die fachgerechte Bekämpfung und Entsorgung, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
31 invasive Pflanzenarten oder -gruppen unterliegen einem Inverkehrbringensverbot. Sie dürfen nicht mehr verkauft, weitergegeben oder neu gepflanzt werden. Bestehende Pflanzenbestände in Gärten oder Anlagen dürfen zwar weiterhin gepflegt werden, doch eine Weiterverbreitung ist ausgeschlossen.
Die Freisetzungsverordnung (FrSV) stützt sich auf das Umweltschutzgesetz (USG) und ist Teil des rechtlichen Rahmens zum Umgang mit gebietsfremden Arten. Bund, Kantone und Gemeinden übernehmen abgestufte Zuständigkeiten bei der Bekämpfung, Information und Kontrolle.
Wer ist für was zuständig?
Die Verantwortlichkeiten im Umgang mit gebietsfremden Arten sind gesetzlich abgestuft geregelt: Der Bund schafft die rechtlichen Grundlagen, führt die Artenlisten und koordiniert den Vollzug. Die Kantone sind für Umsetzung, Überwachung und Bekämpfung zuständig, während die Gemeinden – je nach kantonaler Regelung – Aufgaben in Information, Kontrolle und Vollzug wahrnehmen können. Private sind verpflichtet, die Vorschriften einzuhalten und zur Eindämmung problematischer Arten beizutragen.
Die Zuständigkeiten sind abgestuft:
- Bund (insbesondere das Bundesamt für Umwelt BAFU) erlässt Vorschriften, führt das Artenverzeichnis (Anhänge der FrSV) und koordiniert den Vollzug.
- Kantone sind primär verantwortlich für Vollzug, Überwachung und Bekämpfung.
- Gemeinden können je nach kantonaler Regelung Aufgaben in Information, Kontrolle und Vollzug übernehmen.
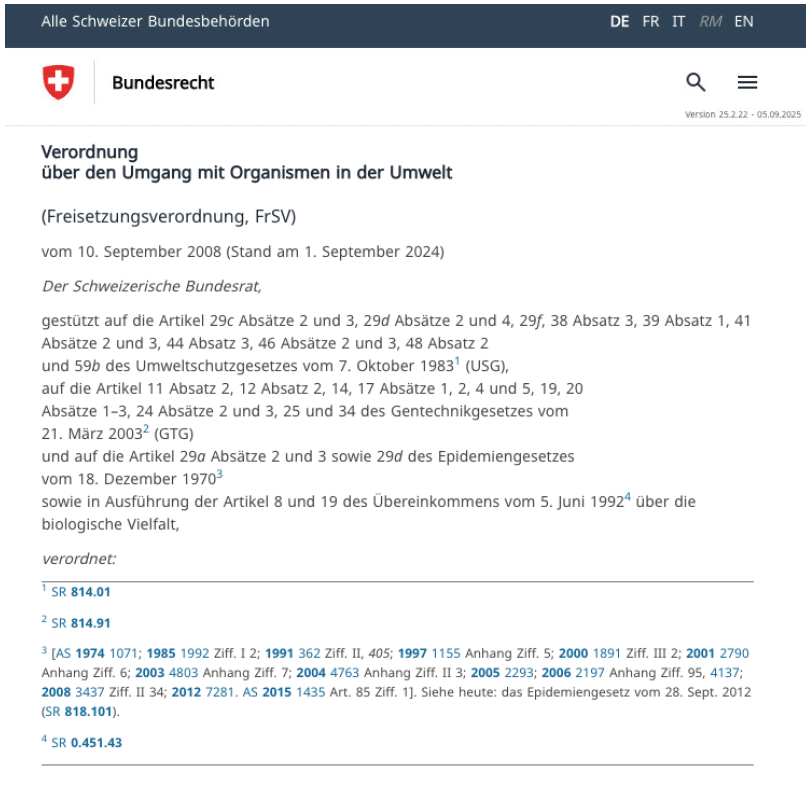
Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt
(Freisetzungsverordnung, FrSV) vom 10. September 2008 (Stand am 1. September 2024)
-> Freisetzungsverordnung, FrSV